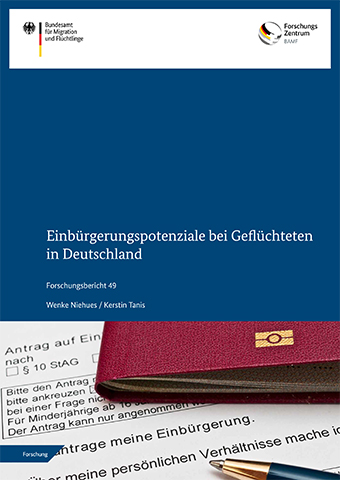Einbürgerung von Geflüchteten , , Eine Analyse auf Basis der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten
Gut zwei bis drei Prozent der ausländischen Staatsangehörigen mit mindestens 10-jährigem Aufenthalt werden jährlich Deutsche. Wie sich das Einbürgerungspotenzial mit Blick auf den Zuzug von Geflüchteten entwickelt, hat das Forschungszentrum des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF-FZ) untersucht. Die beiden Autorinnen, Wenke Niehues und Dr. Kerstin Tanis, berücksichtigen in ihren Analysen auch Änderungen, die sich durch die geplante Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts ergeben. Die Ergebnisse fasst der neue Forschungsbericht "Einbürgerungspotenziale bei Geflüchteten in Deutschland" zusammen.
 Dr. Kerstin Tanis
Quelle: BAMF
Dr. Kerstin Tanis
Quelle: BAMF
Obwohl eine Einbürgerung, also der Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft, mit mehr Rechten (z. B. politischer Mitbestimmung) einhergeht, machen bisher nur wenige ausländische Staatsangehörige davon Gebrauch. Mit dem Zuzug von Geflüchteten und der steigenden Aufenthaltsdauer eben jener Gruppe könnte sich dies jedoch bald ändern. Denn im Gegensatz zu Personen, die aus Erwerbszwecken nach Deutschland gekommen sind, identifizieren sich Schutzsuchende aufgrund des Fluchthintergrunds weniger stark mit ihrem Herkunftsland. Damit ist es wahrscheinlicher, dass sie dauerhaft in Deutschland bleiben und auch deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger werden wollen. Die Studienergebnisse bestätigen dies: "Neun von zehn Geflüchteten konnten sich 2021 vorstellen, sich in Zukunft einbürgern zu lassen. Die Mehrheit der Geflüchteten hat sich auch bereits über die Einbürgerung informiert, die meisten über das Internet und Freunde"
, erklärt Dr. Kerstin Tanis
Eine Einbürgerung erfordert die Erfüllung von mehreren gesetzlichen Voraussetzungen. Für die Abschätzung des Einbürgerungspotenzials werden in der Studie vier zentrale Voraussetzungen beispielhaft herausgegriffen, darunter der Aufenthaltsstatus, die Aufenthaltsdauer, die Sicherung des Lebensunterhalts und Deutschkenntnisse. Die Berechnungen zeigen, dass 2021 16 Prozent der nicht-eingebürgerten Geflüchteten die vier hier betrachteten Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt hätten. Hochgerechnet hätte dies rund 103.000 volljährigen Personen entsprochen. Darüber hinaus hätten 115.000 minderjährige Kinder über den Familienverbund miteingebürgert werden können.
Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts
Die Bundesregierung plant das Staatsangehörigkeitsgesetz zu modernisieren und hat im Sommer 2023 einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die vier hier betrachteten Erteilungsvoraussetzungen teilweise modifiziert. Die Autorinnen haben in ihren Analysen auch die geplanten Änderungen berücksichtigt: Demnach hätten 21 Prozent der Geflüchteten die vier Einbürgerungsvoraussetzungen gleichzeitig erfüllt. Dies hätte für das Jahr 2021 zu einer Steigerung des Einbürgerungspotenzials von fünf Prozentpunkten gegenüber der aktuellen Gesetzeslage geführt. Die Analysen zeigen darüber hinaus, dass auch mit der Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts insbesondere Frauen, Ältere und Personen mit niedrigem Bildungsniveau ein geringeres Einbürgerungspotenzial aufweisen würden, da sie seltener alle vier Einbürgerungsvoraussetzungen gleichzeitig erfüllen.
Einbürgerungspotenziale bei Geflüchteten in Deutschland
Der Forschungsbericht des BAMF analysiert für das Jahr 2021 das Einbürgerungspotenzial Geflüchteter, die zwischen 2013 und 2019 nach Deutschland eingereist sind. Die Analyse basiert auf Daten der sechsten Erhebungswelle der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten.